Die Unterscheidung zwischen (in der Ehe erlaubter) natürlicher Familienplanung und (generell verbotener) künstlicher Empfängnisverhütung wird von den meisten Katholiken nicht geteilt. Manche denken, sie sei allein schon deshalb irrelevant – denn Moral lebt ja davon, dass sie akzeptiert und umgesetzt wird. Stimmt das?
Die Unterscheidung zwischen erlaubter natürlicher Familienplanung und verbotener künstlicher Empfängnisverhütung ist nicht schwer zu verstehen oder darzulegen. Dass sie dennoch von den meisten (deutschen) Katholiken nicht geteilt wird, liegt eher an einer mangelnden Vermittlung und Verkündigung und ist kein Erweis der Irrelevanz.
Die Scheu, diese moralische Position zu verkünden und zu vertreten, ergibt sich aus einem Missverständnis in der Begründung: nicht der Sexualakt nach erfolgter künstlicher Empfängnisverhütung ist in sich schlecht, sondern die Anwendung von Mitteln zur Aussetzung, Verhinderung oder gar Zerstörung der Fruchtbarkeit.
Die Begründung ist für jeden einleuchtend: Die Bekämpfung der Fruchtbarkeit mit chemischen, medizinischen oder mechanischen Mitteln, als wäre diese eine Krankheit, ist eine grobe Missachtung der natürlichen Integrität des Menschen und vielleicht sogar mit vorsätzlicher Körperverletzungen zu vergleichen. Gerade Ehepartner, denen die Elternschaft schmerzlich verwehrt bleibt, wissen um den hohen Wert der ehelichen Fruchtbarkeit. Die Fähigkeit, neues Leben zu empfangen, vorübergehend künstlich, d. h. chemisch oder mechanisch zu unterdrücken oder gar auf Dauer zu zerstören (Sterilisation), widerspricht dem geschuldeten christlichen Respekt gegenüber der uns von Gott geschenkten menschlichen Natur.
Dagegen kann der Sexualakt bei vorliegender Unfruchtbarkeit moralisch nicht bemängelt werden, sondern besitzt auch dann einen eigenen, hohen Wert (Humanae Vitae, Kapitel 11: «Jene Akte (…) bleiben auch sittlich erlaubt bei vorauszusehender Unfruchtbarkeit, wenn deren Ursache keineswegs im Willen der Gatten liegt»). Eine vorliegende Unfruchtbarkeit kann aufgrund von biologischen Störungen, dem Alter der Partner- oder auch nur zeitlich vorliegen, die moralische Integrität des Geschlechtsaktes ist davon nicht abhängig (solange die Fruchtbarkeit nicht gezielt unterdrückt wird). So ist also die bewusste Wahl von unfruchtbaren Zeiten, das den Kern der natürlichen Familienplanung darstellt, moralisch unbedenklich.
Dass moralische Normen von einem großen Teil der Menschen nicht gelebt werden, kann darin liegen, dass die Norm nicht anschaulich oder vermittelbar ist. Das ist offensichtlich bei der kirchlichen Position zu Mitteln der künstlichen Empfängnisverhütung nicht der Fall, auch wenn dieses oft behauptet wird. Die Erfahrung zeigt, dass die hier genannte Begründung, wenn sie vertreten wird, durchaus Anerkennung findet.
Die mangelnde Akzeptanz bei den meisten (deutschen) Katholiken liegt wohl eher an der mangelnden Vermittlung der moralischen Begründung – die ist vielen einfachhin nicht bekannt. Hinzu kommt die oft ausbleibenden Unterstützung durch die kirchliche Gemeinschaft, diesen Wert auch zu leben.
Weitere Artikel zum Thema «Sexualmoral»
- Warum gibt es eine Ehe nur zwischen Mann und Frau?

- Aufsteigender und absteigender Segen:

Den Kern der neuen Regelung verstehen - Klarstellung

zur Erklärung »Fiducia supplicans« - Jesus und die Ehescheidung – Zwischen den Zeilen lesen

- Segnung von homosexuellen Beziehungen? – Ein Plädoyer für mehr Verständnis

- Wieso ist künstliche Verhütung unerlaubt, natürliche Familienplanung aber nicht?

- Sexualmoral – Was soll das?

- Warum ist die Kirche gegen künstliche Empfängnisverhütung?

Weitere Artikel zum Thema «Moral»
- Warum gibt es eine Ehe nur zwischen Mann und Frau?

- Aufsteigender und absteigender Segen:

Den Kern der neuen Regelung verstehen - Klarstellung

zur Erklärung »Fiducia supplicans« - Verdrehte Auslegung: «Der barmherzige Samariter» – Lk 10,25-37

- Sind Corona-Impfstoffe ethisch bedenklich? Sie enthalten doch Embryonen-Zellen, oder?

- Jesus und die Ehescheidung – Zwischen den Zeilen lesen

- Segnung von homosexuellen Beziehungen? – Ein Plädoyer für mehr Verständnis

- Das 3. Gebot: Ahme Gott nach – und lass ihn mal machen

- Wieso ist künstliche Verhütung unerlaubt, natürliche Familienplanung aber nicht?

- Moral braucht keine Religion – aber sie ist hilfreich

- Das Naturrecht: Moral ohne Religion

- Sexualmoral – Was soll das?

Weitere Artikel zum Glauben
- Wollte Gott Mensch werden? Oder auch Mann?

- Warum gibt es eine Ehe nur zwischen Mann und Frau?

- Bibelstellen richtig verstehen:
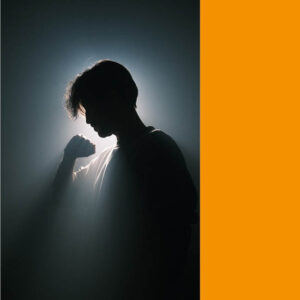
Die Rückkehr der unreinen Geister (Mt 12,43-45) - Aufsteigender und absteigender Segen:

Den Kern der neuen Regelung verstehen - Klarstellung

zur Erklärung »Fiducia supplicans« - Ist «das Blut Christi trinken» nicht ein Widerspruch zum Blutverbot der Juden?

- Die Erzählung vom Abreißen der Ähren (Mt 12,1-8) richtig verstehen

- Wann wurde Jesus geboren?
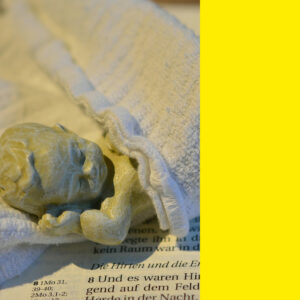
- Fides quae und fides qua – zwei ganz verschiedene Begriffe von Glauben

- Gleichnisse deuten: Die klugen und törichten Jungfrauen – Mt 25,1-13

- Gleichnisse deuten: Das fehlende Hochzeitsgewand – Mt 22,1-14

- Der Mensch ist ein Schatz! – Das Gleichnis vom «Schatz im Acker und der Perle» ist kein moralischer Aufruf, sondern großartiger Zuspruch – Mt 13,44-46

Neueste Artikel
- Fürbitt-Gebet für einen guten neuen Bischof von Münster

- «Heilige Geistin»: Ist der Heilige Geist die weibliche Seite Gottes?

- Gewöhnung

- Buchempfehlungen ’24
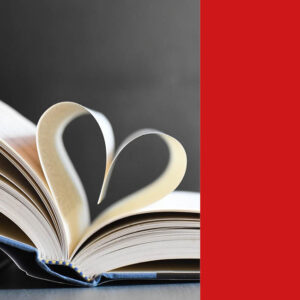
- Wollte Gott Mensch werden? Oder auch Mann?

- Warum gibt es eine Ehe nur zwischen Mann und Frau?

- Bibelstellen richtig verstehen:
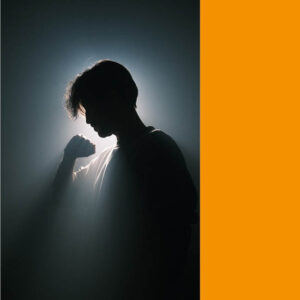
Die Rückkehr der unreinen Geister (Mt 12,43-45) - Was ist wichtiger: Gottesdienst oder Seelsorge?
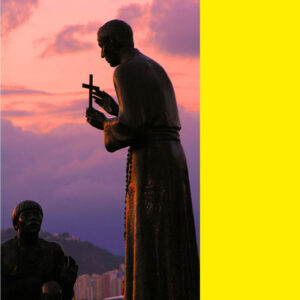
- Warum knien sich Katholiken in der Messe hin?

- Aufsteigender und absteigender Segen:

Den Kern der neuen Regelung verstehen - Klarstellung

zur Erklärung »Fiducia supplicans« - Das Predigtverbot für Laien:
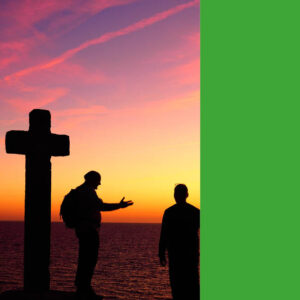
Vom Sinn der Predigt in der Messfeier

