Noch ist die Pandemie-Krise um Corona nicht beendet (ich schreibe diesen Artikel im April 2020). Aber so, wie in der Politik zunächst hektisch versucht wurde, das Bisherige am Leben zu erhalten, stellt sich jetzt auch in der Kirche die Frage, ob wir das wirklich wollen: Weiter so, wie zuvor? Die Politiker, Lobbyisten und Umweltschützer verlangen jetzt schon: Wenn wir das öffentliche Leben wieder «hochfahren», dann aber bitte in einer neuen Qualität!
Eine ähnliche Frage stelle ich mir im Moment auch. Allerdings frage ich nicht unbedingt nach einer besseren Welt und auch nicht nach einer besseren Kirche. Vielmehr möchte ich darüber nachdenken, was wir in der Zeit der Corona-Pandemie für unser kirchliches Leben gelernt haben. Was könnte eine Lehre sein aus der seltsamen Zeit der geschlossenen Kirchen und nicht-öffentlichen Gottesdienste?
Ich musste nicht lange überlegen. Die Antwort ist offensichtlich: Die Keimzelle des Glaubens ist und bleibt die Familie. Dort hat sich nicht nur in den letzten Wochen das soziale Leben konzentriert. Dort war oft der einzige Ort, an dem sich noch Gebet, gelebter Glauben, gelegentlich auch gemeinsamer Gottesdienst und Segen ereignet hat.
Die Familie ist nicht nur das passendste Bild für den Dreifaltigen Gott, sie ist auch das umfassendste Abbild Gottes in dieser Welt. Die Familie wirkt in die Welt hinein. Wenn alles zusammenbricht, bleibt nur noch die Familie. Nicht der Papst, nicht die Bischöfe und auch nicht die Priester
Leider war diese zentrale Stellung der Familie aus vielen Köpfen verschwunden – nicht nur im Denken von Theologen, Medien und Hierarchie – sondern leider auch im Bewusstsein der Familien selbst. Viele glaubten, der eigentliche Ort des erfahrenen und gelebten Glaubens sei die Kirche (oder, noch schlimmer: Das Pfarrheim). Priester und Bischöfen haben oft versäumt, den Familien diesen Irrtum aufzuzeigen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken, haben vieles einer Gemeindetheologie unterworfen und ureigenste Aufgaben der Familien an sich gezogen.
Auch in der Krise war die erste Sorge vieler Seelsorger die Aufrechterhaltung der Gemeindegottesdienste (per gut gemeinten, aber häufig technisch grausigen Online-Gottesdiensten, statisch-sterilen Live-Übertragungen aus pfarrherrlichen Wohnzimmern oder leeren Kirchen). Wenige Initiativen zeichneten sich durch Anregungen für Glauben und Gottesdienst aus, die den Selbstvollzug und den Gottesdienst in den Familien im Fokus hatten.
Hauskirche und Pfarrkirche stehen nicht in einer Konkurrenz, sondern in einem Dienstverhältnis: Die Pfarrkirche dient der Hauskirche
Damit gebe ich nicht den (auch bischöflichen) Stimmen recht, mit der Entdeckung der Hauskirche wäre die Eucharistie als „überschätzt“ entlarvt worden. Nein, Hauskirche und Pfarrkirche stehen nicht in einer Konkurrenz, sondern in einem Dienstverhältnis: Die Pfarrkirche dient der Hauskirche; der Empfang der Sakramente stärkt die Menschen in ihren Familien; feierliche Gottesdienste in Kathedralen finden ihren wichtigsten Widerhall im Leben der Teilnehmenden. Die eigentliche Vorbereitung auf die Sakramente leistet die Familie. Und die Sakramente sind die nötige Vorbereitung für den Dienst der Familie an der Welt.
Das mag lange Zeit übersehen worden sein. Aber nun haben wir das Glück, das kirchliche Leben neu ausrichten zu können. Gebet und Glaubensverkündigung in den Familien zu stärken, dafür Hilfestellungen zu geben und Räume zu ermöglichen, könnte eine neue Akzentuierung der Pastoral einleiten. Ich bin da guter Hoffnung, wie immer, wenn es um Gottes Kirche geht.
Weitere Meinungen / Kommentare
- «Keiner will eine deutsche Nationalkirche!»

Wenn sich WOLLEN und TUN widersprechen… - Das Amt des Bischofs

Geteilte Macht oder verweigerter Dienst? - Überleben im Sturm – Wie umgehen mit der aktuellen Krise der Kirche?

- Die Rolle der Frau Sperlich in der katholischen Kirche heute

- Corona ist nicht heilsrelevant! – Warum weltliche Fragen uns Katholiken nicht entzweien dürfen.

- Fenster auf! Türen auf! Es ist Pfingsten!

- Soll die Kirche aus Solidarität in der Pandemie auf Gottesdienste verzichten?

- Warum ich mich nicht „konservativ“ nenne

- Kirche 2.0 – Eine noch radikalere Reform der Kirche (1/2)

- Priestermangel? – Wo kein Bedarf, da ist auch kein Mangel.

- Die Themen der Kirche

- …Gräben ohne Brücken? – Zur Lage der deutschen Kirche

Unsere neuesten Artikel
- Aufsteigender und absteigender Segen:

Den Kern der neuen Regelung verstehen - Klarstellung

zur Erklärung »Fiducia supplicans« - Das Predigtverbot für Laien:

Vom Sinn der Predigt in der Messfeier - Warum Kevelaer ein «eucharistischer» Wallfahrtsort ist

- «Keiner will eine deutsche Nationalkirche!»

Wenn sich WOLLEN und TUN widersprechen… - Freiheit vs. Gehorsam: Wie erkenne ich selbst und frei, was wahr und wirklich ist?
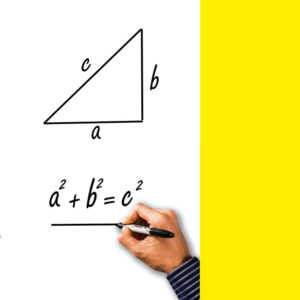
- Wie kann es sein, dass Ostern den Tod überwunden hat? Es sterben doch immer noch Menschen!

- Ist «das Blut Christi trinken» nicht ein Widerspruch zum Blutverbot der Juden?

- Die Erzählung vom Abreißen der Ähren (Mt 12,1-8) richtig verstehen

- Das Amt des Bischofs

Geteilte Macht oder verweigerter Dienst? - Die Feier der Trauung – mit vielen Hinweisen und allen Texten

- Die katholische Trauung – Ein Pfarrer erklärt, was möglich und sinnvoll ist

